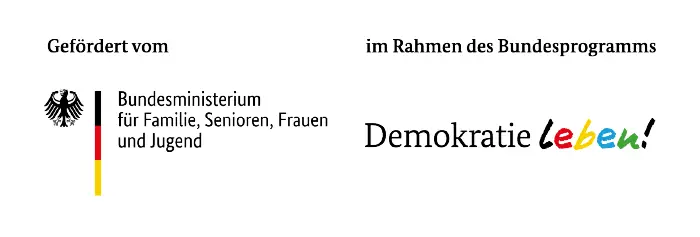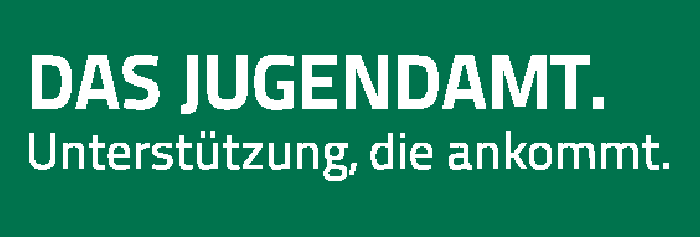Die Ausstellung
Navigating Between Gravities:
Jüdisches Leben in Berlin, Damals und Jetzt
Die digitale Ausstellung „Navigating Between Gravities“ ist die Einladung zu einer vielschichtigen Reise entlang eines Kontinuums, das sich durch die jüdische Vergangenheit und Gegenwart zieht, und durch drei der lebendigsten und vielfältigsten Bezirke Berlins – Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln.
Die Ausstellung überblendet Schichten des gegenwärtigen jüdischen Lebens und historische Schichten, manifest in Ansichten und Stätten vergangener jüdischer Präsenz, und verbindet dergestalt die Gegenwart mit der Vergangenheit. Die historische Schicht der Ausstellungskarte erlaubt es den Besucherinnen und Besuchern, mit dem Un-gegenwärtigen umzugehen: Mit dem, was nicht mehr ist, und was dennoch da ist – indem sie Spuren eines jüdischen Lebens visualisiert, das einst in diesen Nachbarschaften blühte, vor dem Aufstieg des Nazi-Regimes. Diese Schicht überlagernd zeigt die Karte eine zweite, die der Gegenwart gewidmet ist und die Stimmen und Perspektiven versammelt, Biographien und Bilder, Aktionen, Geschichten und Gesten von jüdischen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Organisationen als Reaktionen auf die Terrorattacke gegen Israel am 7. Oktober sowie auf den verheerenden Krieg in Gaza, den sie zur Folge hatte.
Die beispiellos grausamen Akte der Hamas stellten eine schwere Erschütterung jüdischer Existenz in Israel und in der Diaspora dar, ließen hier wie dort die Verwundbarkeit von Jüdinnen und Juden erkennbar werden und weckten Ängste, die über Generationen weitergegeben worden waren. Der andauernde und eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat dabei die Verankerungen und Gewissheiten jüdischen Lebens in Berlin empfindlich getroffen, und ein allgemeines Gefühl der Gefährdung durch Antisemitismus und antisemitische Gewalt nahm im vergangenen Jahr signifikant zu. In den drei Bezirken, in denen die verschiedensten migrantischen Gruppen zuhause sind, haben sich als Folge des politischen Konflikts auch entlang dieser gesellschaftlichen Trennlinien die Spannungen verschoben und intensiviert.
Einige der Künstler*innen und Organisationen erzählten uns vom Verlust ihres Sicherheitsgefühls; manche sprachen vom Verlust eines Zugehörigkeitsgefühls unter bestimmten Teilen der politischen Linken; manche schufen Räume, um Trauma, Verlust und Trauer zu artikulieren; einige setzten sich für die Schaffung und Stärkung des jüdisch-muslimischen interreligiösen Dialogs und für die Formierung neuer Allianzen ein; manche beteiligten sich am zivilgesellschaftlich-demokratischen Kampf in Israel gegen die gegenwärtige rechtsextreme Regierung; einige forderten uns auf, nachdrücklich auf das Leiden anderer zu reagieren, obwohl oder gerade weil sie anders sind; manche forderten ein Ende des Krieges.
Diese Ausstellung hat daher den Anspruch, als gesellschaftlicher Raum zu dienen, in dem zwischen komplexen Diskussionen und Reflexionen navigiert werden kann, um dadurch die Vision eines reichen, diversen und heterogenen jüdischen Lebens in Berlin zu vermitteln, ein Leben, das von Verbundenheit, Solidarität, Offenheit und Toleranz geprägt ist.
Wir möchten uns gerne bei allen zur Ausstellung Beitragenden dafür bedanken, dass sie ihre Arbeit, ihre Gedanken und Einsichten mit uns geteilt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Jeremy Borovitz, Guy David Briller, Marina Chernivsky, Fraenkelufer Synagogue, Marina Frenk, Hillel Deutschland, Noa Heyne, Hori Izhaki, Jewish Moving Pictures e.V., Olaf Kühnemann, Laba Berlin, Dekel Peretz, Ariel Reichman, Maja Sorjef und das Jüdische Museum Berlin.
Auch Maya Rotman, der Web-Designerin für die Ausstellung, sowie Einav Vaisman, die für die Illustrationen der interaktiven Karte verantwortlich war, danken wir herzlich für ihre Arbeit, Kollaboration und ihre hervorragenden Anstrengungen.
Und schließlich möchten wir Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA) Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V. und Nachbarschaftsheim Neukölln unseren aufrichtigen Dank aussprechen, für die gemeinsame Arbeit, Inspiration und Unterstützung.
Sapir Huberman & Dr. Debby Farber, die Kuratorinnen der Ausstellung